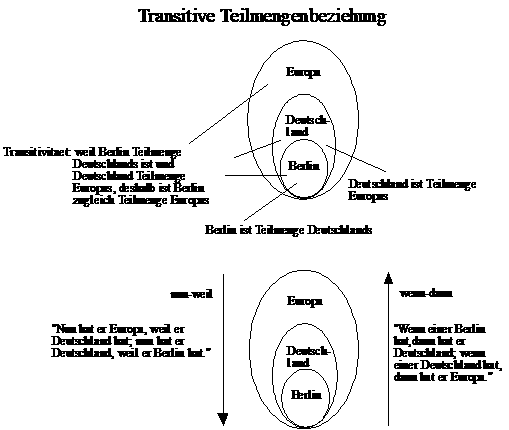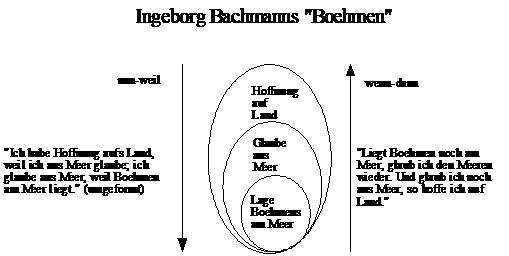|
Chinesische Rhetorik oder "Lehre vom Zurechtlegen der Worte"
|
26. Dingzhen 頂針 "Fingerhut"
Die Worte so zurechtlegen, dass ein Wort (Wortgruppe) vom
Satzende des vorhergehenden sich am Satzanfang des darauffolgenden Satzes wiederholt, nennt man "Dingzhen".
BeispieleKlassisches Chinesisch
夫寵而不驕,驕而能降,降而不憾, 憾而能眕者,鮮矣.
Solche, die begünstigt und nicht arrogant sind, die arrogant sind und sich unterordnen können, die untergeordnet und nicht unzufrieden sind, die unzufrieden sind und sich zurückhalten können, gibt es wenige.
Quelle: "Kommentar des Zuo",
siehe Xiucixue
S. 332
Modernes Chinesisch
宅中有園, 園中
有屋, 屋中有院, 院
中有樹, 樹上見天,
天中有月. 不亦快哉!
Im Gebäude ist ein Park, im Park ein Haus, im Haus ein Hof, im Hof ein Baum, vom Baum sieht man den Himmel, im Himmel ist der Mond. Ist das nicht eine Freude!
Quelle: Lin Yutang "Taiwan",
siehe Xiucixue
S. 332 f.
Erinnert an ...
Ausführliche ErklärungDer folgende Text ist gleich dem im Buch Xiucixue S. 329 ff.A. Das Wortzurechtlegemuster1. HinführungDer "Fingerhut" ist die Verkettung von Sätzen. Ein Wort am Satzende wird zu Anfang des nachfolgenden Satzes wiederholt. Hinter dieser äußeren Satzform verbirgt sich nicht selten eine logische Gesetzmäßigkeit, welche im Folgenden "transitive Teilmengenbeziehung" genannt wird. 1 Wir folgen dir, weil wir dir glauben; wir glauben dir, weil wir dich kennen. 2 ist ein Beispiel, das der politischen Rede entstammt. Die zugrundeliegende Gedankenform ist aber auch in der Dichtung anzutreffen, wie Ingeborg Bachmanns Gedicht Böhmen liegt am Meer beweist: Liegt Böhmen noch am Meer, glaub ich den Meeren wieder. / Und glaub ich noch ans Meer, so hoffe ich auf Land. 3 Worin besteht die "transitive Teilmengenbeziehung" in dem Satz Wer Berlin hat, hat Deutschland; wer Deutschland hat, hat Europa. 4 ? Berlin ist Teilmenge Deutschlands und Deutschland ist Teilmenge Europas, folglich ist Berlin Teilmenge Europas. In diesem logischen Schluss wird die Transitivität der Teilmengenbeziehung ausgedrückt. Wenn A Teilmenge von B ist und B ist Teilmenge von C, so muss A Teilmenge von C sein: Wer Berlin [= A] hat, hat Deutschland [= B]; wer Deutschland [= B] hat, hat Europa [= C]. Die Satzverkettung auf der Grundlage der transitiven Teilmengenbeziehung ist in zwei Formen möglich, wobei die eine die Umkehrung der anderen darstellt, so dass jede der beiden Arten in die andere transformierbar ist: 1. "Wenn-dann"-Verkettung (konditionale Beziehung): Die Beziehung verläuft von der kleinsten Teilmenge hin zur größten. Wenn einer Berlin hat, dann hat er Deutschland; wenn einer Deutschland hat, dann hat er Europa. 2. "Nun-weil"-Verkettung (faktische Beziehung): Die Beziehung verläuft umgekehrt von der größten Teilmenge hin zur kleinsten. Nun hat er Europa, weil er Deutschland hat; nun hat er Deutschland, weil er Berlin hat.
Dass sich auch hinter dem literarischen Text von Ingeborg Bachmann logisch eine transitive Teilmengenbeziehung verbirgt, veranschaulicht die folgende Grafik:
2. Das Wort "dingzhen"頂 ding ist der "Scheitel" (頭頂 touding "Kopfscheitel"). Dies wird durch die linke Hälfte, 丁, in der Weise symbolisiert, dass der waagrechte Strich auf dem senkrechten zu liegen kommt. 針 zhen ist die "Nadel". "Scheitel" und "Nadel" zusammen bedeuten 頂針 dingzhen "Fingerhut", da der Fingerhut die Nadel während des Treibens der Nadel durch einen dicken Stoff gleichsam auf seinem Kopf trägt. Das 首字 shouzi "Kopfzeichen", das erste Zeichen des nachfolgenden Satzes, trägt in der chinesischen Schreibweise von oben nach unten analog das 末 mozi "Endzeichen" auf seinem Kopf, das ist das letzte Schriftzeichen des vorangehenden Satzes. 5 3. BegriffsbestimmungDas Dingzhen ist das Ergebnis der Iteration eines oder mehrere Schriftzeichen (Wörter) in der Weise, dass sich die Gleichheit je einer der beiden Enden zweier Schriftzeichen-Reihen (Wörter-Reihen) im Kontakt ergibt ("Spiegelung" des Endglieds im Anfangsglied: /...X//X.../). Der Gegensatz zum Dingzhen wäre die Gleichheit auf Distanz ("Kyklos": /X...//...X/ versus "Anapher": /X...//X.../ versus "Epipher" /...X//...X/). In semantischer Hinsicht bedeutet diese Art der Satz-Verknüpfung eine Bildungsmöglichkeit von Textkohärenz. 4. BeispieleIn den folgenden zwei Beispielen wird das Wort des vorangehenden Satzendes am darauffolgenden Satzanfang wiederholt. Auf diese Weise der Wiederholung entsteht jeweils eine homogene Satzreihe, welche zu einem Höhepunkt treibt und in diesem zur Ruhe kommt.
5. Die fortlaufend verschobene IdentitätDas Dingzhen ermöglicht das fortlaufende Identifizieren von Subjekts- und Prädikatsbegriff. – Voraussetzung für das Verständnis dieser Behauptung ist, dass man sich der wesentlichen Bestandteile eines logischen Urteils bewusst ist, denn "Subjekt" und "Prädikat" sind hier nicht im grammatischen, sondern logischen Wortverständnis gemeint. Ein einfaches Urteil wie beispielsweise Das Gold ist gelb. setzt sich aus vier Momenten zusammen, von welchen drei durch Wortzeichen sichtbar sind, das vierte hingegen hinzugedacht werden muss. Das gedachte Moment ist der Charakter des Satzes nicht als eines In-Frage-Stellens, sondern Behauptens. "Gold" ist der Subjektsbegriff (S). Er zeigt den Gegenstand an, welcher einem Urteil unterworfen wird, das ist das Gold als materieller Stoff. Das Wort "gelb" bildet den Prädikatsbegriff (P). Er bezeichnet eine Bestimmtheit, ein Merkmal, das dem Gegenstand als Merkmalsträger sprachlich zugeordnet wird. Die Zuordnung geschieht vermittels des Relators (Kopula) "ist". "Die drei Glieder des Urteils sind in bestimmter Weise zueinander geordnet. Das erste und grundlegende Glied ist der Subjektsbegriff. An ihn schließt die primäre Funktion der Kopula an und führt hinüber zum Prädikatsbegriff, greift durch diesen hindurch und bezieht die Prädikatsbestimmtheit hin auf den Subjektsgegenstand, der durch den Subjektsbegriff untergehalten und durchgehalten wird; darauf legt sich über das Ganze die zweite Kopulafunktion, die Behauptung, abschließend hinüber." 8 Der sprachliche Ausdruck kann diese logische Ordnung verändern, das heißt, der logischen Ordnung der Glieder braucht die sprachlichen Ordnung der Glieder nicht entsprechen. Subjekts- und Prädikatsbegriff können zum Beispiel den Platz tauschen (Gelb ist das Gold.). Diese Unterscheidung ist wichtig, da die verschobene Identität von Subjekts- und Prädikatsbegriff, welche vermittels des Dingzhen hergestellt werden kann, nur für solche einfache Aussagen über Gegenstände gilt, in welchen die sprachliche Gliedabfolge die logische widerspiegelt. In einem logischen Urteil wird einem Merkmalsträger ein Merkmal zugeordnet. Da über das Merkmal selbst ebenso etwas ausgesagt werden kann, so kann das Merkmal ebenso als Gegenstand fungieren, über welchen ein Urteil gefällt wird, das heißt, das Merkmal kann selbst zum Merkmalsträger gemacht werden. Das Merkmal "gelb" beispielsweise dient in dem Satz Das Gelb ist ausstrahlend. als Gegenstand, über welchen etwas ausgesagt wird. In dem Satz Das Gold ist gelb. ist "gelb" der Prädikatsbegriff. In dem Satz Das Gelb ist ausstrahlend. ist "gelb" der Subjektsbegriff. Der Prädikatsbegriff ist also zu einem Subjektsbegriff geworden. Da der Prädikatsbegriff "hell" wiederum zu einem Gegenstand gemacht werden kann, über welchen etwas ausgesagt wird (z.B. Das Ausstrahlende ist hell.), so ergibt sich auf diese Weise eine fortlaufend verschobene Identität von Prädikats- und Subjektsbegriff, deren sprachliches Gewand das Dingzhen bildet: Das Gold ist gelb, das Gelb ist ausstrahlend, das Ausstrahlende ist hell: S1 ist P1, S2 (= P1) ist P2, S3 (=P2) ist P3. 6. Einteilung und ArtenDas Dingzhen wird nach der Art des Verbundenen eingeteilt. Es lassen sich Sätze oder Textabschnitte durch gleiche End- und Anfangsglieder verbinden. Entsprechend differenzieren sich die beiden Hauptarten. 9
a) "Gereihte-Perlen-Muster" (聯珠格 lianzhuge)Die Verkettung von Sätzen wird nach dem Bild der Perlenkette "Gereihte-Perlen-Muster" genannt. Ein oder mehrere Wörter am Satzende des vorhergehenden Satzes werden am Anfang des nächstfolgenden wiederholt. Zwei Beispiele sind bereits oben angeführt worden. b) "Verbundene-Ringe-Körper" (連環體 lianhuanti)Die Verkettung von Absätzen wird "Verbundene-Ringe-Körper" genannt. Ein oder mehrere Wörter am Absatzende des vorhergehenden Absatzes (z.B. Lied-, Gedicht-Strophe) werden am Anfang des nächstfolgenden wiederholt. Zahlreiche Beispiele im klassischen Chinesisch finden sich im Buch der Lieder. 10 Ein Textbeispiel im modernem Chinesisch findet sich zu Anfang der folgenden "Gebrauchsregeln". B. Die Gebrauchsregeln
1 Vgl. SEIFFERT 1973 63 ff. 2 LEMMERMANN 126. 3 Hinck 83. 4 LEMMERMANN 126. 5 Ich folge im Bezeichnen des Wortzurechtlegemusters WANG TIANQING 120. 陳望道 Chen Wangdao: 修辭學發凡 Xiucixue fafan "Grundriss der Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Shanghai, Jiaoyu chubanshe 1979, S. 216 und 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 499 schreiben 頂真 anstelle von 頂針. 頂真 dingzhen bedeutet unter anderem "äußerst wahr", wobei die "Wahrheit" in der Überschaubarkeit und logischen Kohärenz des Textzusammenhangs zu suchen ist, welche das Dingzhen ermöglicht. 6 左傳 Zuo zhuan "Kommentar des Zuo", 僖公 Xi gong "Herzog Xi", 三年 San nian "Drittes Jahr". Zit. n. 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 505. Vgl. ZUOZHUAN 14. 7 林語堂 Lin Yutang: 來臺後二十四快事 Lai Tai hou ershisi kuaishi "24 erfreuliche Ereignisse nach der Ankunft auf Taiwan". Zit. n. 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 506. 8 PFÄNDER 1921 181. 9 S. 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 502 ff., vgl. 陳望道 Chen Wangdao: 修辭學發凡 Xiucixue fafan "Grundriss der Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Shanghai, Jiaoyu chubanshe 1979, S. 116 ff. 10 詩經 Shi jing "Buch der Lieder", z.B. 大雅 Da ya, 生民之什 Sheng min zhi shi: 既醉 Ji zui. Vgl. SHIJING 1880 415 f., SHIJING 1950 205, SHIJING 1985 475 ff. Zum Lianhuanti als eine häufige Bauweise der 雅 ya "Elegante Lieder" vgl. CHEN SHOUYI 19. 11 徐志摩 Xu Zhimo: 再別康橋 Zai bie Kangqiao "Nochmaliger Abschied von Cambridge". Zit. n. 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 512. 12 司馬遷 Sima Qian: 史記 Shi ji "Historische Aufzeichnungen", 刺客列傳 Cike liezhuan "Biographien von Attentätern". Zit. n. 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 514. Vgl. SIMA QIAN 1969 64 f. 13 Vgl. LINK 78 f. 14 貫云石 Guan Yunshi: 紅繡鞋 Hong xiu xie "Rote gestickte Schuhe". Zit. n. 黃慶萱 Huang Qingxuan: 修辭學 Xiucixue "Lehre vom Zurechtlegen der Worte", Taibei, Sanmin shuju 1988, S. 514. |
||||||||||||||||||||||||||||